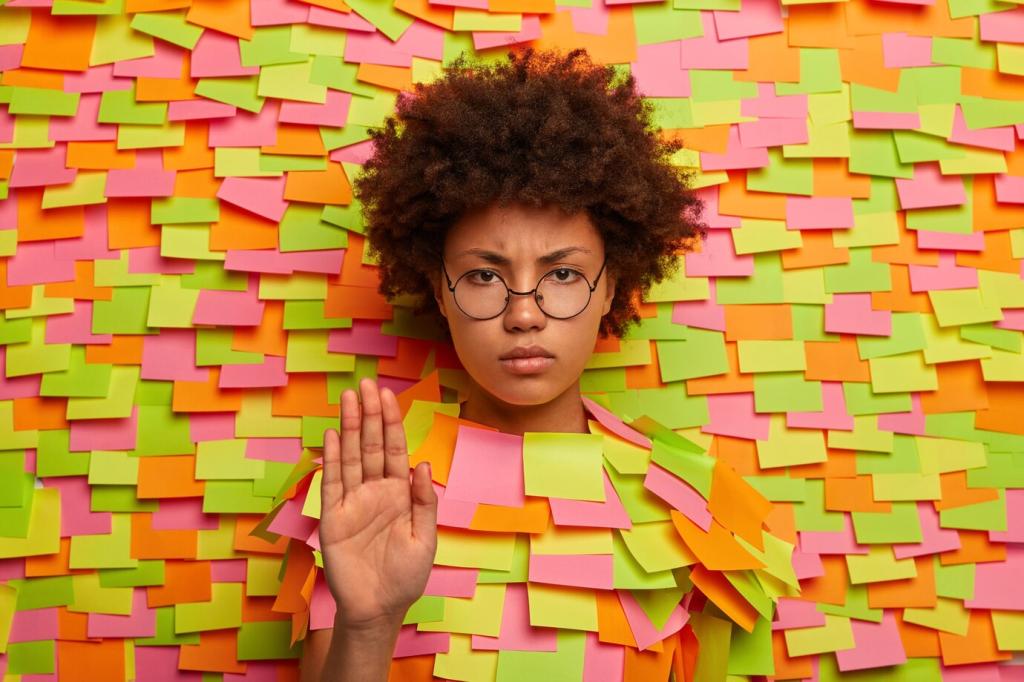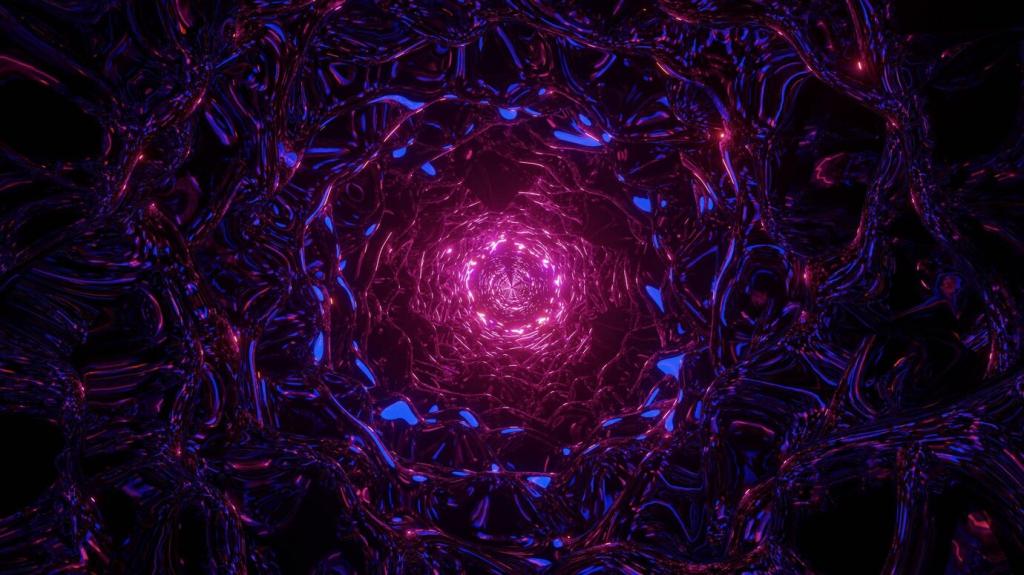Wie wir das Unsichtbare sehen: Beobachtungen und Instrumente
Interferometrie über den Erdball verbindet Radioteleskope zu einem virtuellen Erdteleskop. So entsteht ein Bild des Schattens, geprägt durch gekrümmte Lichtbahnen. Die Größe testet Allgemeine Relativität und liefert Dichten, Feldstärken und Rotationshinweise im innersten Akkretionsfluss.
Wie wir das Unsichtbare sehen: Beobachtungen und Instrumente
Gaia kartiert Sternbewegungen, ALMA sieht kaltes Gas, Spektren verraten Geschwindigkeiten über Dopplerverschiebung. Zusammen zeichnen sie Rotationsfelder, Masseverteilungen und Zuflüsse nach. So wird sichtbar, wie galaktische Dynamik zentrale Schwarze Löcher nährt oder ausdünnt.
Wie wir das Unsichtbare sehen: Beobachtungen und Instrumente
Laserinterferometer messen winzigste Längenänderungen, wenn Gravitationswellen die Erde durchdringen. Die Signale offenbaren Verschmelzungen Schwarzer Löcher in fernen Galaxien. Künftige Detektoren werden supermassereiche Paare und ihre kosmischen Umweltbedingungen noch präziser hörbar machen.